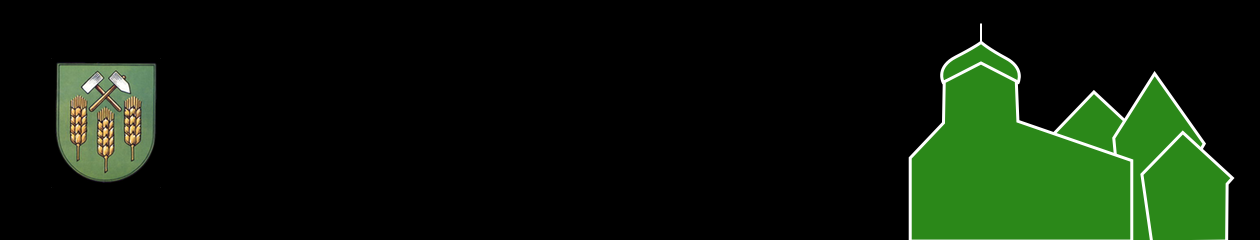Detlev Herbst
Die Salze und ihre Bedeutung
Die Salze zählen zu den Mineralien. Sie werden in Speisesalz und Kalisalz unterschieden.
Speisesalz
Schon seit Urzeiten kommt dem Salz eine besondere Bedeutung zu. Der Mensch benutzt es seit der Jungsteinzeit, um seine Speisen zu würzen und um Fleisch und Fisch zu konservieren. Salz ist für den menschlichen Organismus unentbehrlich. Es ist für den Menschen wie auch für alle pflanzenfressenden Tiere – wohl dosiert – ein lebenswichtiges Mineral. Das menschliche Blut enthält etwa ein Prozent an gelösten Salzen, deren größten Anteil Kochsalz bildet.
Seit 150 Jahren gehört Salz auch zu den wichtigsten Grundstoffen der anorganischen chemischen Industrie. Dort dient es unter anderem als Grundstoff für die Herstellung von Soda, von Wasserenthärtern, von Glasuren für Steinzeug, von Gerbemitteln, von Entwicklungssalzen für Fotolabors und als Zusatz zu Bohrspülungen in der Mineralölindustrie. Darüber hinaus wird es zum Konservieren von Lebensmitteln, als Futterzusatz, in der Metallurgie, in der Medizin und als Auftausalz bei vereisten Straßen verwendet.
Salz begegnet uns im Alltag unter verschiedenen Bezeichnungen. Speisesalz, Kochsalz und Siedesalz sind die üblichen Bezeichnungen für im Handel befindliches reines Natriumchlorid mit einem Anteil von 98 % NaCl. Es wird durch Vermahlen von bergmännisch abgebautem Steinsalz oder durch Eindampfen von gesättigten Solen in Salinen als Sole – oder Sudsalz gewonnen (1). Bei Siedehitze getrocknet, ergibt es das weiße, feinkörnige Siedesalz , das auch als Tafelsalz bezeichnet wird. Die erste bergmännische Gewinnung von Steinsalz fand vor 3000 Jahren in Hallstatt im Salzkammergut statt.
In wärmeren Ländern gewinnt man Meer-oder Seesalz durch Eindunsten von Meerwasser in Salinen oder Salzgärten.
Kalisalz
Im Jahre 1840 stellte Justus von Liebig aufgrund eingehender Untersuchungen fest, dass nicht allein Licht, Luft, Wasser und Humus für das Wachstum von Pflanzen notwendig sind, sondern die Zufuhr von Mineralien für ihre Ernährung ausschlaggebend ist. Er erkannte dabei die besondere Bedeutung des Kaliums als Pflanzennährstoff. Kalium, ein metallisches Element, kommt in der Natur nicht in reiner Form vor, sondern stets in Verbindungen mit Magnesium oder Natrium. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Kali fast ausschließlich aus pflanzlichen Verbrennungsrückständen in Form von Pottasche (K2 CO 3) gewonnen. Die Köhler im Solling gewannen Pottasche als Nebenprodukt der Holzverkohlung. Pottasche wurde hauptsächlich zur Herstellung von Seife und Glas, von Schieß – und Sprengpulver und zum Bleichen und Gerben verwendet. Daran änderte sich auch nach der Aufnahme der bergmännischen Gewinnung von Kalisalzen im Jahre 1860 vorerst nichts. Im Zusammenhang mit den Kriegen von 1864, 1866 und 1870 / 71 nahm die Verwendung für die Herstellung von Sprengstoffen sogar noch zu. Es trifft also nicht zu, dass unmittelbar nach der Entdeckung der Bedeutung der Kalisalze für das Pflanzenwachstum die Produktion von Kalidüngemitteln in großem Umfang einsetzte. Justus von Liebig starb 1873 und erlebte den Siegeszug des Kalidüngers in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts nicht mehr. Erst dann setzte sich bei den Landwirten allmählich die Erkenntnis durch, dass durch die planmäßige Zufuhr mineralischer Nährstoffe die Erträge steigen und leistungsfähigere Pflanzen gezüchtet werden können. Außerdem ermöglichte die Anwendung mineralischer Düngemittel eine Steigerung der Flächenerträge und eine erhebliche Senkung der landwirtschaftlichen Produktionskosten.
Bei den Kalisalzen handelt es sich um Doppelsalze und Gemische von Chlor (Cl) und Schwefel (S) mit Natrium (Na), Kalium (K) und Magnesium (Mg). Sie enthalten neben dem begehrten Kalium noch weitere für das Pflanzenwachstum wichtige Mineralien. Die wichtigsten in den deutschen Salzlagerstätten vorkommenden Kalisalze sind: Carnallit (KMgCl3 6H2O), Sylvin (KCl), Kainit (MgSO4KCl 3H2O), Kieserit (MgSO4 H2O) und Hartsalz, das aus einem Gemenge von Steinsalz, Sylvin , Kieserit und Ton besteht.
Die Entstehung der norddeutschen Salzlagerstätten
In der Zechsteinzeit vor 240 Millionen Jahren waren große Teile Mitteleuropas von einem Binnenmeer bedeckt, das sich im Norden bis nach Schleswig – Holstein, im Osten bis nach Polen und im Süden bis an den Neckar erstreckte. An seinen Rändern bildeten sich Meeresbecken, die nur noch durch seichte Meerengen (Barren) mit dem offenen Meer in Verbindung standen. Infolge starker Sonneneinstrahlung – es herrschte ein wüstenähnliches Klima – war die Wasserverdunstung vor allem in den lagunenartigen Randzonen größer als die Zuflüsse. Infolgedessen reicherte sich der Salzgehalt dermaßen an, dass sich die schwer löslichen Stoffe ausschieden. Zuerst setzte sich Salzton ab. Mit fortschreitender Verdunstung wurden die Karbonate Kalk und Dolomit, die Sulfate Gips und Anhydrit, danach Steinsalz und zuletzt Kali – und Magnesiumsalze ausgeschieden. Dieser Vorgang wiederholte sich durch den unterschiedlich starken Zustrom des Meerwassers mehrere Male. Heiße, trockene Stürme bedeckten schließlich die eingetrocknete Salzfläche mit Staub, aus dem sich eine schützende, aus Salzton bestehende Decke über den Kalisalzen bildete und diese bei späteren Überflutungen vor der Auflösung bewahrte.
Die Salze des Zechstein im norddeutschen Raum liegen normalerweise in einer Tiefe zwischen 2000 und 4000 m. Da Salz plastisch ist und unter hohem Druck zu „fließen“ beginnt, wurden Teile davon später infolge gewaltiger geologischer Umwälzungen innerhalb der Erdkruste hochgedrückt. Sie befinden sich daher heute in erreichbarer Nähe zur Erdoberfläche. Diese Vorgänge fanden nicht gleichmäßig statt. Daher sind die Salzstöcke stark verworfen und bilden häufig große Sättel. Die Gewinnung der Salze wird dadurch erschwert, dass die Flöze in dem während der Aufstiegsphase plastischen Steinsalz gleichsam miteinander verknetet wurden und deshalb in scheinbar wirr gefalteter Form vorliegen.
Die norddeutschen Lagerstätten werden als „steile Lagerung“ bezeichnet.
Stein – und Kalisalzvorkommen im südlichen Niedersachsen
Salinen
Das Gebiet des heutigen Niedersachsen zeichnet sich durch besonderen Salzreichtum aus. Vom Mittelalter bis in die heutige Zeit haben unsere Vorfahren das seit Jahrtausenden für den Menschen unentbehrliche Salz aus Solequellen in Salinen gewonnen. Von den 116 in Deutschland bekannten Salinen sind allein 26 für das heutige Niedersachsen dokumentiert, davon vier im südlichen Niedersachsen (Emons/Walter 1988,117/118). In den meisten dieser Orte weisen noch heute die Bestandteile „Salz“, “Süll“, oder „hall“, Straßennamen oder die Pfannhaken der Salzsieder in den Ortsnamen bzw. Ortswappen auf die Salzgewinnung hin.
Die frühesten Hinweise auf Solevorkommen in unserer Region finden sich in einer Urkunde Ludwigs des Frommen aus dem Jahre 833, in der die Solequellen des Ortes Bodenfelde der Reichsabtei Corvey übereignet werden (Junge 1983, 27).
Als einzige Saline in Deutschland produziert noch heute die Saline Luisenhall in Göttingen Pfannensalz.
Salinen im südlichen Niedersachsen ( Emons/Walter 1988, 118)
Ort Dauer der Produktion
| Bodenfelde bei Uslar | vor 1833 | bis 1687 |
| Salzderhelden bei Einbeck | vor 1173 | bis 1960 |
| Sülbeck bei Einbeck | 1694 | bis 1950 |
| Göttingen | 1854 | bis heute Kalisalz |
Die ersten Kalisalzlagerstätten in Deutschland wurden eher zufällig in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts entdeckt. Die Preußische Regierung ließ im Jahre 1852 die beiden Schächte „von der Heydt“ und „von Manteuffel“ bei Staßfurt abteufen, um Steinsalz bergmännisch zu gewinnen. Dabei traf man über den Steinsalzlagern auf bitter schmeckende Salze, die Kalium und Magnesium enthielten. Sie wurden zunächst als wertlose Abraumsalze aufgehaldet. Adolf Frank erkannte schon bald die große wirtschaftliche Bedeutung dieser „Abraumsalze“ als Ausgangsstoff für die Herstellung von kaliumhaltigen Düngemitteln und gründete 1861 in Staßfurt eine Fabrik zu ihrer Verarbeitung. In den folgenden Jahren wurde eine Reihe von Schächten abgeteuft, um vor allem diese „Abraumsalze“ zu gewinnen.
Im Jahre 1883 wurde in Vienenburg am Harz mit der Schachtanlage „Hercynia“ das erste Kalibergwerk im Königreich Hannover abgeteuft. Entgegen der Lehrmeinung des bekannten Geologen Ochsenius, dass südlich des Harzes keine Kalisalze zu finden seien, wurde man 1888 auch dort bei Probebohrungen kalifündig. Die Kalisalzlager im deutschen Zechsteingebiet werden in folgende Lagerstättenbezirke eingeteilt: Nordhannover, Südhannover, Magdeburg – Halberstadt, Unstrut – Saale, Südharz, Hessen – Thüringen und Niederrhein. Die Salzvorkommen im südlichen Niedersachsen gehören zum Bezirk Magdeburg – Halberstadt. Allerdings ist diese Einordnung nicht ganz unumstritten. Nach Ansicht Beyschlags beginnt im Westen jenseits der Oker bereits das südhannoversche Gebiet, das sich ohne natürliche Grenze aus dem Südharzgebiet entwickelt und das Eichsfeld und das westlich des großen Leinegrabens gelegene Buntsandsteinplateau des Sollings und des Reinhardswaldes umfasst (Beyschlag 1907, 16).
Anfang der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts sicherten sich in zahlreichen Orten
Südniedersachsens verschiedene Bohr – und Bergbaugesellschaften das Recht,
Stein – und Kalisalze abzubauen, und erwarben dort Gerechtsamen (2).
Vorhaben zur Erschließung abbauwürdiger Kalisalzvorkommen bis 1907
(Paxmann 1907, 152 ff.)
Name der GesellschaftOrt ErgebnisGewerkschaft AlexandraReiffenhausen / Göttingennicht gebohrtBohrgesellschaft Barbarossa IImbsen / Dransfeldnicht fündigBohrgesellschaft Barbarossa IIVarlosen / Dransfeldnicht fündigKalibohrgesellschaft ConcordiaVogelbeck /EinbeckaufgelöstBohrgesellschaft DortmundErtinghausen /Hardegsenkalifündig, aufgelöstGewerkschaft EllenhallDörrigsen / Ibernicht gebohrtBohrgesellschaft ElvershausenGandersheimaufgelöstGewerkschaft GandersheimHarste / GöttingensteinsalzfündigGewerkschaft Germania IReiffenhausen / Göttingennicht gebohrtGewerkschaft GertrudenhallNörtenProbebohrungen begonnenGewerkschaft Glückauf SollingBollensen /Uslarnicht fündigGewerkschaft GroneGöttingenunbekanntGewerkschaft GroneImmensen /SülbeckkalifündigBohrgesellschaft HardegsenHardegsensteinsalzfündig, aufgelöstBohrgesellschaft HarsteHarste / Göttingennicht fündig, aufgelöstBohrgesellschaft HarzhornOldenrodenicht gebohrt, aufgelöstGewerkschaft HedwigshallEspol, Trögen / MoringenunbekanntGewerkschaft HeleneKalefeld, östl. EinbeckProbebohrungen begonnenBohrgesellschaft HellmuthDörrigsen /EinbecksteinsalzfündigGewerkschaft HildasglückErtinghausen / HardegsenkalifündigBohrgesellschaft HohenstauffenUslar , Hann. Mündennicht gebohrtGewerkschaft Justus IVolpriehausenkalifündigBohrgesellschaft KaiserhallAdelebsen /Göttingennoch nicht gebohrtGewerkschaft KarolinenhallLaubach /Hann. Mündennicht gebohrtGewerkschaft KönigshallReyershausen / GöttingenkalifündigGewerkschaft LouisenhallMoringen kalifündigBohrgesellschaft MonopolDörrigsen /Einbeckkalifündig, aufgelöstBohrgesellschaft MündenMündener Stadtwaldnicht gebohrt, aufgelöstBohrgesellschaft NesselroedenNesselroeden /Duderstadtnicht fündigBohrgesellschaft SalzderheldenImmensenunbekanntSaline SülbeckSülbeck / EinbeckSole erbohrtGewerkschaft TillyHann. MündenunbekanntBohrgesellschaft VictoriaSebexen /Osterodekalifündig, aufgelöstBergwerks G.m.b.H. WestfaliaDasselnicht fündigWestf.-Lipp. Bergwerks G.m.b.H.Göttingen nicht gebohrt
In den meisten Orten blieb es beim Erwerb der Gerechtsamen, aus finanziellen Erwägungen wurden keine Probebohrungen vorgenommen. Überall dort, wo man nicht fündig geworden war, gab man die Gerechtsamen wieder auf. Nur acht Schachtanlagen wurden schließlich gebaut.
Kali – und Steinsalzbergwerke in Südniedersachsen
( Slotta 1980 , 390, 479, 484 , 695)
| NAME | FÖRDERZEITRAUM | ORT |
|---|---|---|
| „ JUSTUS I“ „WITTEKIND – HILDASGLÜCK“ |
VOLPRIEHAUSEN BEI USLAR | 1901 – 1938 |
| „SIEGFRIED I UND SIEGFRIED II “ |
VOGELBECK BEI SALZDERHELDEN | 1907 – 1927 |
| „OBERHOF – REINHARDSBRUNN“ | SUDHEIM BEI NORTHEIM | 1911 – 1922 GING NIE IN FÖRDERUNG |
| „NAPOLEON“ „KÖNIGSHALL – HINDENBURG“ |
REYERSHAUSEN BEI GÖTTINGEN | 1913 – 1969 |
Die „ Bergbau AG Justus“ und die „Wittekind Bergbau AG“
Am 31.März 1895 schloss der Chemiker und Ingenieur Dr. Emil Hilberg aus Essen mit zwanzig Grundbesitzern, der Kirchengemeinde und dem Schulvorstand der Gemeinde Volpriehausen einen Kalisalzvertrag ab. Die unterzeichneten Grundeigen-
tümer räumten darin Hilberg das Recht ein, erschlossene Kali – und Steinsalzlager
abzubauen und auf den betreffenden Grundstücken Förderanlagen, eine Fabrik und
andere Gebäude zu errichten. Geplante Bohrungen waren dem Grundeigentümer vorher anzuzeigen. Für die in Anspruch genommenen Flächen waren pro Morgen jährlich 300 Mark Pacht zu zahlen. Der Kaufpreis für einen Morgen wurde auf 1200 Mark festgesetzt. Als Entschädigung für die bergmännische Ausbeutung wurden den Grundeigentümern pro Doppelzentner Kalisalz vier Pfennig, pro Doppelzentner Steinsalz zwei Pfennig Förderzins gezahlt. Für durch Feuer und Rauch verursachte Schäden und Bergschäden übernahm die Gesellschaft die Verantwortung. Ebenso erklärte sich Hilberg bereit, durch den Bergbau bedingte Mehrkosten für die Erweiterung der Schule, des Friedhofs, für die Einstellung von Lehrern und für die Verbesserung der örtlichen Infrastruktur zu übernehmen.
Im Jahre 1897 übertrug Hilberg den Vertrag auf die Gewerkschaft „Justus I“ in Köln, die 1895 gegründet worden war (3). Der Geltungsbereich des Vertrags wurde dabei auf die meisten Gemeinden des Kreises Uslar ausgedehnt. Dadurch verfügte die Gesellschaft über eine Gerechtsame , die einer Fläche von 1710 ha entsprach.
Die Gewerkschaft „Justus I“ wurde 1906 in eine Aktiengesellschaft mit einem Kapital von fünf Millionen Mark umgewandelt und in das Handelsregister beim Amtsgericht Uslar eingetragen. Sitz der „Bergbau AG Justus I“ war Volpriehausen.
1921 wurde das Aktienkapital der Gesellschaft um 15 Millionen Mark auf 20 Millionen Mark erhöht. Dadurch gelangte die „Bergbau AG Justus“ in den Besitz der Aktienmehrheit der Gewerkschaften „Carlshall“ und „Ellers“. Zusammen mit der Gewerkschaft „Hildasglück“ bei Volpriehausen bildeten nun diese Werke mit dem Werk „Justus“, das in „Wittekind umbenannt wurde, einen Konzern, der sich „Bergbau AG Wittekind“ nannte.
Noch im selben Jahr erwarb die „Gewerkschaft Krügerhall“ , die zum Burbach – Konzern gehörte, nach einer Kapitalerhöhung die Aktienmehrheit der Wittekind – Gruppe. Im Jahre 1928 wurden die Auflösung der Gewerkschaft „Hildasglück“ und die Veräußerung des Gesamtvermögens an die Burbach-Kaliwerke AG beschlossen. Durch den damit verbundenen Aktienumtausch wurde nach „Hildasglück“ nun auch „Wittekind“ fest in den Burbach- Konzern eingebunden.
Die Schachtanlagen „Justus I“ / „Wittekind“ und „Hildasglück“
Das Werk „Justus I“ / „Wittekind“
In den Jahren 1896 bis 1898 wurden drei Tiefbohrungen am Ostrand Volpriehausens niedergebracht, von denen zwei kalifündig waren.
Profil der Tiefbohrungen :
( Deutsche Kali-Industrie 1906, 106)
Buntsandstein bis 260 m Teufe
Ton bis 311 m Teufe
Ton mit Gipsbänken, Anhyditeinlagerung bis 361 m Teufe
Jüngeres Steinsalz bis 410 m Teufe
Hauptanhydrit bis 464 m Teufe
Salzton bis 469 m Teufe
Kalilager bis 475 m Teufe
Unreines Kalisalz bis 488 m Teufe
Älteres Kalilager bis 497 m Teufe
Unreines Steinsalz bis 522 m Teufe
Kalilager bis 527 m Teufe
Steinsalz nicht abbauwürdig bis 537 m Teufe
Reines Steinsalz bis 545 m Teufe
Älteres Steinsalz bis zum Grundgebirge bis 550 m Teufe
Nach dem Gutachten des Geologen Professor Dr. Kloos lag im Bereich Volpriehausen ein von Norden nach Süden streichender Sattel vor. Daraufhin wurde beschlossen, einen Schacht abzuteufen. Mit dem Abteufen wurde noch 1898 begonnen. Im Juni 1900 erreichte man die Kalisalzlagerstätten und im Februar 1901 wurde der Schacht fertiggestellt. Die Schachtanlage „Justus I“ ging damit als 29. Kalibergwerk im Deutschen Reich in Förderung.
Die Schachtröhre war 558 m tief und hatte einen Durchmesser von 4,25 m. Sie war bis zu einer Tiefe von neun Metern ausgemauert, bis 125,4 m Tiefe mit Tübbingen, (gusseisernen Röhren) ausgekleidet und bis zur Endteufe dann wieder ausgemauert.
Die Schachtröhre war eingeteilt in zwei Fördertrume für die Förderkörbe, ein Fahrtrum mit einem Leitersystem, das als Fluchtweg gedacht war, und ein Wettertrum für die Belüftung des Untertagebereichs .
Die Hauptsohle , die zugleich Fördersohle war, lag in 540 m Tiefe. Nebensohlen waren von der Schachtröhre in 444 m , 452 m und 580 m Tiefe abgeschlagen worden. Mehrere Blindschächte führten bis zur 660 m bzw. bis zur 786 m – Sohle herunter.
Nach der Fertigstellung der Schachtröhre wurden von diesen Blindschächten aus auf neu angelegten Sohlen in 480 m, 494 m, 518 m, 534 m , 540 m und 595 m Tiefe Querschläge nach Westen und Osten getrieben. Die in 480 m, 494 m und 518 m Tiefe angelegten Fördersohlen wurden allerdings schon im Jahre 1904 wieder stillgelegt. Seit dieser Zeit wurde nur noch die 540 m – Sohle als Fördersohle genutzt
Im Werk Wittekind wurde hauptsächlich das Flöz Stassfurt des Zechstein abgebaut, das als Hartsalz ausgebildet ist, und Carnallit und Kainit. Die Analysen der Kalisalze ergaben in den drei Lagern einen Chlorkaliumgehalt (K 2O) zwischen 20 und 28%. Die kalihaltigen Schichten wiesen nur eine geringe Mächtigkeit auf. Sie wurden immer wieder von Schichten der Nebensalze und von Anhydrit – und Tonschnüren durchzogen.
Unter dem Flöz Stassfurt war eine Partie reines weißes Steinsalz ausgebildet, das als Speisesalz gewonnen wurde.
Das Werk „Hildasglück“
Im Jahre 1901 übernahm die „Bergbau AG Justus“ die Gerechtsamen der „ KalibohrGesellschaft Dortmund“ bei Ertinghausen, die unmittelbar an die eigenen Gerechtsamen grenzten, um dort den notwendigen zweiten Schacht abzuteufen.
In den Jahren 1906 und 1909 wurden zwei Bohrungen niedergebracht, die in einer Tiefe zwischen 576 und 903 m kalifündig wurden .
Profil der Tiefbohrungen:
(Herbst 1983, 242)
Buntsandstein bis 560 m
Ton bis 580 m
Steinsalz mit Anhydrit bis 638 m
Anhydrit bis 660 m
Steinsalz bis 675 m
Anhydrit bis 765 m
Steinsalz bis 798 m
Anhydrit bis 892 m
Salzton bis 898 m
Hartsalz bis 902 m
Älteres Steinsalz bis 947 m
Schon ein Jahr nach der dritten Bohrung war die Schachtröhre bis in eine Tiefe von 160 m fertiggestellt. Wegen starker Wasserzuflüsse verzögerte sich ihre Fertigstellung bis zur Endteufe von 949 m erheblich, so dass erst 1915 die Fertigstellung erfolgen konnte.
Die Schachtröhre hatte einen lichten Durchmesser von 5,25 m. Sie war auf den ersten 25 Metern ausgemauert. Von 25 m bis 577 m – Tiefe war sie mit einem Tübbingausbau versehen. Der übrige Teil der Schachtröhre war wiederum bis zur Endteufe ausgemauert. Die starken Wasserzuflüsse konnten nur unter erheblichen Schwierigkeiten bewältigt werden. Trotz des tiefgehenden Tübbingausbaus musste ständig eine größere Wassermenge aus dem Schacht gehoben werden.
Wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten und der Kriegsereignisse konnte das Werk „Hildasglück“ erst im Jahre 1919 in Betrieb genommen werden.. Die Aufschlussarbeiten im Kalilager und der Durchschlag zum Werk „Wittekind“ erfolgten erst später. Im Jahre 1931 wurden beide Schachtanlagen durch einen 1250 m langen Querschlag von der 605 m – Sohle des Werkes „Wittekind“ über einen Blindschacht mit der 917 m – Sohle des Werkes „Hildasglück“ verbunden. „Wittekind“ blieb auch danach der Förderschacht, während „Hildasglück“ als Reserve – und Wetterschacht diente.
.
Die Übertageanlagen
Nach dem Abschluss der Teufarbeiten wurde mit dem Bau der Tagesanlagen begonnen.
Weithin sichtbar überragte das Fördergerüst mit der Schachthalle das Betriebs- gelände. Daneben befand sich das Fördermaschinenhaus mit einer großen Dampffördermaschine, die bei jedem Zuge sechs Förderwagen auf drei Etagen heben konnte. Zur Dampferzeugung diente ein modernes Kesselhaus mit drei Röhrenkesseln von je 250 qm Heizfläche und Braunkohlenfeuerung, System Keilmann & Völcker. Die Braunkohle wurde bis 1910 aus dem Tagebau der „Consolidierten Sollinger Braunkohlenwerke“ in Delliehausen, danach aus dem Kassler Revier angeliefert. Die elektrische Zentrale war mit drei Kolbendampfmaschinen der MAN ausgestattet, von denen zwei eine Leistung von 900 KVA und eine von 450 KVA erbrachten. Zur Sicherung der Stromversorgung war das Werk noch an die Überlandzentrale der Edertalsperre angeschlossen. Im Jahre 1912 wurde ein neues Elektrizitätswerk mit einer Leistung von 2000 PS errichtet, um auch den im Bau befindlichen Schacht „ Hildasglück“ mit elektrischer Energie versorgen zu können (Burbach-Konzern 1928, 59).
Die Mahlanlagen für Hart- und Steinsalz bestanden aus je einem Steinbrecher, je zwei Glockenmühlen und zwei Walzenstühlen mit einer Leistungsfähigkeit von 60 t
pro Stunde. Mechanische Verladeapparate führten das gemahlene Salz den Güterwaggons zu. Im Schachtgebäude war noch eine Hammermühle zum Zerkleinern der Salzbrocken vorhanden.
Unmittelbar neben der Hauptmühle wurde 1923 ein Speicher mit einem Fassungsvermögen von 180.000 dz errichtet. Um der starken Nachfrage in der Frühjahrskampagne, der Hauptbezugszeit der Landwirtschaft, zu genügen, war unter Tage ein weiterer Speicherraum ausgesprengt worden, der den Inhalt von 4000 Eisenbahnwaggons aufnehmen konnte.
Die Chlorkaliumfabrik , die 1904 in Betrieb ging, konnte täglich bis zu 4000 dz Hartsalze verarbeiten, die angeschlossene Sulfatfabrik bis zu 150 Zentner Kaliumsulfat produzieren. Beide Fabriken wurden 1921 stillgelegt und an die Chem. Fabriken Billwärder, eine Tochtergesellschaft der Burbach AG verpachtet. Im Jahre 1905 wurde die Saline, die mit je einer Feuer-, Rauch-, Dampf- und zwei Trockenpfannen arbeitete, fertiggestellt.
Neben den bereits erwähnten Tagesanlagen gab es noch verschiedene Werkstätten, Magazingebäude, ein Labor, einen Wasserturm, die Kaue und das Verwaltungsgebäude auf dem Werksgelände.
Auf dem Werksgelände der Schachtanlage „Hildasglück“ befanden sich das Fördergerüst mit der Schachthalle, das Fördermaschinenhaus, Magazine , Werkstätten, ein Wasserturm und das Verwaltungsgebäude. Diese Gebäude waren 1915 fertiggestellt worden.
Die Arbeit unter Tage
In der steilen Lagerung des Volpriehäuser Salzstocks wurde der Abbau der Salze im Firstkammerbau betrieben. Dabei wurden langgestreckte Abbauörter ( Kammern ) mit Hilfe von Bohr – und Sprengarbeit angelegt. Zum Bohren der Sprenglöcher wurden anfangs mit Pressluft , später elektrisch betriebene Säulendrehbohrmaschinen eingesetzt. Die Bohrmaschinen, die ein Gewicht von mehr als 8o kg hatten, wurden in eine Säule (Rahmen) eingehängt und von einem Hauer und einem Lehrhauer bedient. Zur Vorbereitung einer Sprengung mussten zwischen 25 und 30 Bohrlöcher von zwei bis drei Metern Tiefe gebohrt werden. Nach der Fertigstellung eines jeden Bohrlochs mussten die Säule und die Bohrmaschine abgebaut und an der nächsten Bohrstelle wieder aufgestellt werden. Als Sprengmittel dienten verschiedene Sprengstoffe, die nach der Härte und Art der Salze ausgewählt wurden.
Die ganze Höhe der Firste, die im allgemeinen zwischen neun und elf Metern lag, wurde in mehreren Abschnitten herausgesprengt. . Die Hauer standen bei ihrer Arbeit auf dem losgesprengten Salzgestein. Zum Aufstellen der Bohrmaschinen wurde ein aus kurzen Latten und Bohlen hergestelltes Gerüst zu Hilfe genommen. Das Vortreiben der Firste geschah in ihrer ganzen Breite. Die Breite der Kammern richtete sich nach der Mächtigkeit der Lagerstätte. Sie betrug zwischen neun und 37 m. Mehrere Kammern bildeten ein Feld. Zwischen den einzelnen Kammern mussten aus Sicherheitsgründen Bergfesten (Pfeiler) stehenbleiben. Sie hatten eine Mächtigkeit zwischen sechs und zehn Metern, bei Hauptpfeilern bis zu 25 Metern. Das Salz dieser Pfeiler durfte nicht abgebaut werden.
Nach den Sprengungen, die in der Zeit des Schichtwechsels erfolgten, fanden die Bergleute gewaltige Berge von Haufwerk vor. Dann mussten die Bahnleger zuerst Schwellen und Gleise von der Fördersohle in den neuen Abbau verlegen, so dass die Förderwagen, die zwischen zehn und zwölf Doppelzentner Salz aufnehmen konnten, dorthin geschoben werden und die Fördermänner mit der Förderung beginnen konnten. Die Fördermänner leisteten Schwerstarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Sie arbeiteten im Gedinge (Akkord) und mussten im Verlaufe einer Acht – Stunden – Schicht bis zu 22 Förderwagen mit Salzgestein füllen. Ihr Tagesschichtlohn betrug im Jahre 1907 3,50 Mark.
Wo es die Verhältnisse erlaubten , wurde das Salzgestein auf Schüttelrutschen – einem Transportband vergleichbar – mechanisch aus dem Abbau zu den Förderwagen befördert. In den dreissiger Jahren wurden vermehrt Schrappergefässe eingesetzt. Dabei handelte es sich um offene Eisenkästen ohne Boden und Vorderwand. Sie wurden von einer Seilwinde in das Haufwerk gezogen und füllten sich dabei. Anschließend wurden sie zu einer Sammelstelle gezogen. Von dort wurde das Salz mit Hilfe einer Schüttelrutsche zu den Förderwagen gebracht. Durch den Einsatz von Schrappergefäßen wurden viele Bergleute arbeitslos, da jetzt ein Bergmann die Arbeit allein erledigen konnte, für die vorher zehn Bergleute nötig waren.
In der Anfangszeit des Kalibergbaus in Volpriehausen wurden die Förderwagen von Grubenpferden zum Schacht gezogen, später von mit Benzol oder elektrischem Strom betriebenen Lokomotiven. Am Füllort wurden jeweils zwei Förderwagen in drei Etagen auf den Förderkorb geschoben und zur Mühle und zur weiteren Verarbeitung in der Fabrik nach über Tage gebracht.
Von besonderer Bedeutung war die Bewetterung (Versorgung mit Frischluft) des Untertagebereiches. Auf der Fördersohle des Werkes „Wittekind“ herrschte in 540 m Tiefe eine Temperatur von 25 – 28°, im Werk „Hildasglück“ in 917 m Tiefe eine Temperatur von über 30 °, durchaus mit Wüstenklima vergleichbar. Bei diesen Temperaturen und dem allgegenwärtigen feinen Salzstaub war es wichtig, dass die Bergleute in ausreichendem Maße Flüssigkeit zu sich nahmen. Es war durchaus nicht außergewöhnlich, dass Bergleute in einer Schicht fünf Liter Kaffee oder Tee tranken. Um die Versorgung der Grubenbaue mit frischer Luft sicherzustellen, befanden sich auf dem Werk „Hildasglück“ starke Ventilatoren, die frische Luft nach unter Tage leiteten. Die Versorgung mit Frischluft war in den ausgedehnten Grubenbauen sehr kompliziert . Damit der Wetterstrom nicht auf dem kürzesten Wege wieder aus dem Bergwerk herauszog, sondern möglichst alle Strecken und Baue erreichte, musste er durch den Einbau von Verschlägen, Wettertüren und Wetterscheidern zurückgehalten, geleitet und gelenkt werden.
Die bergpolizeilichen Vorschriften verlangten die Wiederverfüllung der leergeförderten Kalisalzabbaue . Hierzu diente entweder älteres Steinsalz, das in Bergemühlen untertage gewonnen wurde, oder Rückstände aus der Fabrikverarbeitung, die in fester Form oder als gesättigte Salzlösung in die leergeförderten Abbaue eingespült wurden (Jacob /Kabitzsch 1929, 14 ff.).
Besonders in der Anfangszeit des Kalibergbaus waren die Arbeitsbedingungen und die Sicherheitsvorkehrungen untertage unzureichend. Die „ Sollinger Nachrichten“ berichteten immer wieder von schweren Unfällen , häufig mit Todesfolge, die vor allem auf menschliches oder technisches Versagen zurückzuführen waren. So kam es öfter vor, dass bei Sprengungen die Zündung erst dann erfolgte, als die Förderleute schon bei der Arbeit waren, dass sich von der Firste zentnerschwere Salzplatten lösten, die nicht rechtzeitig bemerkt worden waren, dass vollbeladene Förderwagen umkippten , da die Gleise unsachgemäß verlegt waren, oder dass Bergleute mit den elektrischen Fahrdrähten der Grubenbahn in Berührung kamen.
Herstellung und Vertrieb der Produkte
Die chemische Industrie verlangte ein hochprozentiges von den Nebenbestandteilen befreites Chlorkalium. Auch in der Landwirtschaft stellte sich bald die Verwendung reiner, hochkonzentrierter Salze als vorteilhafter für die Anwendung heraus. Hinzu kam , dass sich dadurch die Frachtkosten verbilligen ließen. Diese Gründe führten dazu, die Kalirohsalze durch Weiterverarbeitung in chemischen Fabriken in hochprozentige Fabrikate zu verwandeln.
In Volpriehausen bestand seit 1904 eine Chlorkaliumfabrik zur Weiterverarbeitung der Rohsalze. Dort wurden die Rohsalze mit einer heißen Löselauge behandelt, wobei das Chlorkalium in Lösung ging und die Nebenbestandteile zurückblieben. Die abgeschiedenen Kalisalze wurden von der anhaftenden Lauge getrennt, getrocknet und fein gemahlen. Anschließend wurden sie mit geeigneten Laugen behandelt und auf den gewünschten Kaligehalt gebracht. Das Kainit-Hartsalz mit 12 – 15% K2O wurde lediglich fein gemahlen. Es war das preisgünstigste Düngemittel und wurde als Hederich-Kainit auch zur Unkrautvernichtung eingesetzt. Neben Kainit wurden in Volpriehausen noch 30 er Düngesalz mit 28-32 %, 40 er Düngesalz mit 38 – 42 %, 50 er Düngesalz mit 48 – 52 %, Schwefelsaures Kali mit 48 – 52 % und Kalimagnesia (Patentkali) mit 26 – 30 % Reinkaligehalt hergestellt. Nach 1934 wurden nur noch Kainit und Steinsalz abgebaut und verarbeitet.
Die Landwirte aus der Region konnten das in 100 kg – Säcken abgepackte Speise – und Düngesalz direkt vom Werk beziehen. Auch der kostengünstigere Bezug unverpackter Salze und kleinerer Mengen war möglich. In der Inflationszeit konnten wegen der ständigen Geldentwertung kaum noch Verkaufspreise kalkuliert werden. Außerdem verschlechterte sich auch auf dem Lande die Versorgung mit den Grundnahrungsmitteln. Deshalb bot das Kaliwerk den Landwirten den Tausch von Kartoffeln, Brotgetreide und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen gegen Kali -, Speise- und Viehsalz an.
Der Versand der Salze erfolgte überwiegend mit der Bahn. Das Kaliwerk Wittekind besaß unmittelbaren Bahnanschluss an die Station Volpriehausen der Bahnlinie Northeim – Ottbergen, die die Wirtschaftszentren im Osten und im Westen miteinander verband.
Im Jahre 1925 ließ die „Wittekind Bergbau AG“ in Bodenfelde an der Weser eine eigene Hafenanlage erbauen, die nur 14 km vom Werk entfernt war. Von dort wurden die für den Export bestimmten Kaliprodukte auf Lastkähnen nach Bremen befördert, wo sich die Speicher des Deutschen Kalisyndikats befanden. Die Kali – und Steinsalze machten im Jahre 1930 22% des gesamten Warenumschlags im Bodenfelder Hafen aus (von Stempel / Stein 1931, 106).
Im Laufe eines Jahres setzte die Bergbau AG Wittekind durchschnittlich 11 000 Waggons Kali-, Stein – und Siedesalz ab (Burbach-Konzern 1928, 59). Der Exportanteil lag bis Anfang der dreissiger Jahre zwischen 50 und 60%.
Der große Streik im Jahre 1906
Der Kalibergbau erlebte zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Zeit großer wirtschaftlicher Blüte. In den Jahren 1902 bis 1905 hatte das Kaliwerk „Justus I“ jeweils Überschüsse in Höhe von mehr als 800 000 Mark erzielt. Nach den Berechnungen der Werksleitung hatte jeder Bergmann einen durchschnittlichen Gewinn von 133 Mark pro Monat erarbeitet. Der Wochenlohn eines Fördermannes dagegen lag 1906 mit 21 Mark am Rande des Existenzminimums, da die durchschnittlichen Aufwendungen für den Lebensunterhalt in einem Vierpersonenhaushalt 21,98 Mark betrugen ( Verband Deutscher Bergarbeiter 1906, 2).
Für März 1906 waren von der Reichsregierung erhebliche Preiserhöhungen für Lebensmittel wegen einer Erhöhung der Zollsätze angekündigt worden. Zeitgleich verfügte die Werksleitung eine Lohnkürzung von 15 – 18 % für Förderleute.
Daraufhin forderte die Belegschaft die Erhöhung der Schichtlöhne für Hauer auf 4 Mark, für Lehrhauer auf 3, 80 Mark, für Förderleute auf 3, 50 Mark, für Arbeiter im Alter von 14 – 15 Jahren auf 1, 75 , von 15 – 16 Jahren auf 2,00 Mark, von 16 bis 18 Jahren auf 3,00 Mark sowie eine Erhöhung der Akkordlöhne um 15 %. Sie begründete ihre Forderungen mit den steigenden Lebenshaltungskosten und einer Angleichung der Löhne an die der anderen Kaliwerke.
Da die Werksleitung im ganzen nur einer Erhöhung der Schichtlöhne um 5 % zustimmte – damit wäre nicht einmal die angekündigte Lohnkürzung ausgeglichen worden – beschlossen die Arbeiter am 8. März 1906, in den Ausstand zu treten. Nach einer Meldung der „Sollinger Nachrichten“ folgten mehr als 770 Belegschaftsmitglieder dem Streikaufruf. Die meisten von ihnen waren im Deutschen Bergarbeiterverband gewerkschaftlich organisiert. Noch am selben Tag wurden Polizisten „zum Schutze der Arbeitswilligen“ an die Bahnhöfe in Uslar, Volpriehausen und Uslar abkommandiert. Zur Unterstützung der Streikenden reisten hohe Funktionäre des Verbandes aus Hannover an. Ihnen gelang es , auch die Frauen der Bergarbeiter von der Notwendigkeit des Streiks zu überzeugen.
Nach 14 Tagen zeichneten sich im Werk immer größere Schwierigkeiten ab, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Die Werksleitung versuchte deshalb, eine größere Anzahl junger, nicht ausgebildeter Freiwilliger für die Arbeit unter Tage zu gewinnen. Für die Streikenden hatte die Werksleitung zwischenzeitlich Lohnkürzungen vorgenommen und die Entlassung von „Rädelsführern“ angekündigt. Der Bergarbeiterverband versuchte unterdessen durch Unterstützungszahlungen in Höhe des halben Lohns, wenigstens die größte Not der Streikenden zu lindern.
Nach einem gescheiterten Vermittlungsversuch des Oberbergamtes Clausthal am 26. März begann die Streikfront langsam zu bröckeln. Am 1. April meldete der „Volkswille“ dass der Streik beendet sei und die Belegschaft die Arbeit zu den alten Bedingungen wieder aufgenommen habe.
Mehr als drei Wochen hatten die Bergleute unter hohem persönlichen Einsatz und großen finanziellen Opfern durchgehalten – doch vergeblich. Viele von ihnen hatten ihren Arbeitsplatz verloren. Qualifizierte Arbeitskräfte waren in andere Reviere abgewandert, was in der Folge zu größeren Problemen führte. Der Bergarbeiterverband hatte nämlich die „Sperre“ über das Werk Justus verhängt, um den Zuzug qualifizierter Bergarbeiter nach Volpriehausen zu verhindern.
Vom Bauerndorf zum Industriestandort
Gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts war die Sollingregion zum „Armenhaus des Königreichs Hannover“ geworden. Ihre Einwohner lebten hauptsächlich von den kargen Erträgen der Land- und Waldwirtschaft und vom Wegebau. Industriebetriebe waren nicht vorhanden, da die Verkehrsanbindung sehr ungünstig war.
Erst der Bau der Sollingbahn in den Jahren 1874 – 78 leitete die Wende ein. Volpriehausen erhielt einen Bahnhof und wurde Verladestation für die Basaltsteine der Bramburg bei Adelebsen, die auf einer Feldbahn über den Rothenburg nach Volpriehausen gebracht wurden. Nach der Erschließung eines Braunkohlentagebaus in Delliehausen wurde am Bahnhof in Volpriehausen eine Brikett- und Farbenfabrik erbaut, in der die Braunkohle verarbeitet wurde.
Durch den Bau des Kaliwerks stieg der Bedarf an Arbeitskräften innerhalb kurzer Zeit dermaßen an, dass die lange Zeit brachliegenden einheimischen Reserven nicht mehr ausreichten. Aus dem Harz, dem Ruhrgebiet, dem Kalirevier um Magdeburg-Aschersleben und aus Oberschlesien zogen zahlreiche arbeitslose Bergleute nach Volpriehausen, um hier Arbeit zu finden. Unter ihnen befanden sich erstmals nach der Reformation auch wieder Katholiken. Die Bevölkerung Volpriehausens und der Nachbardörfer wuchs in einem atemberaubenden Tempo.
Die Bevölkerungsentwicklung in den vier Bollertdörfern
(Gemeindelexika 1897 und 1908)
- 1905
_____________________________________________________________
| Delliehausen | 507 | 637 |
| Gierswalde | 241 | 461 |
| Schlarpe | 458 | 691 |
| Volpriehausen | 436 | 1040 |
Die in Jahrhunderten gewachsenen gesellschaftlichen Strukturen des Dorfs hielten diesem Ansturm und den damit verbundenen Veränderungen nicht stand und lösten sich auf. Viele landwirtschaftliche Hilfskräfte waren nicht länger bereit, für einen „Hungerlohn“ zu arbeiten. Sie zogen die Arbeit im Kaliwerk bei besserer Bezahlung und einer geregelten Arbeitszeit vor. Unterschiedliche Erfahrungen und Lebensweisen prallten bei den Einheimischen und Fremden unvorbereitet aufeinander und gestalteten das Zusammenleben nicht immer problemlos. Innerhalb kurzer Zeit sahen sich die „Einheimischen“ in die Rolle einer Minderheit im eigenen Dorf versetzt. Die „Neubürger“ beanspruchten mehr und mehr ihren Anteil an der Gestaltung des politischen Lebens. Sie ließen sich bei Wahlen als Kandidaten aufstellen und wurden schließlich von der neuen Mehrheit in den Gemeinderat und sogar zum Gemeindevorsteher gewählt. Der Generaldirektor der Burbach Bergbau AG, Helmut Albrecht, der sich 1920 in Volpriehausen niederließ, war von 1920 bis 1932 Abgeordneter der DVP im Deutschen Reichstag.
Der alte Dorfkern mit den bäuerlichen Anwesen um die Kirche herum war nicht länger Mittelpunkt des Dorfes. Den Neubürgern blieb es verwehrt, dort Land zu erwerben. Sie wurden an die Dorfränder gedrängt, wo bald eine rege Bautätigkeit einsetzte. Für die Direktoren und leitenden Angestellten des Kaliwerks wurden von der Werksleitung repräsentative Villen und Wohnhäuser gebaut, die heute noch das Ortsbild prägen. Sie lebten dort weitgehend vom Dorfgeschehen isoliert und pflegten den Lebensstil der „feinen Leute“ Die meisten Bergleute wohnten anfangs bei Bauern zur Untermiete. In ihrer Freizeit betätigten sich viele von ihnen als Nebenerwerbslandwirte, um ein besseres Auskommen zu haben. Einigen gelang es im Laufe der Zeit, Land zu erwerben und sich ein kleines Haus zu bauen .Die Reichsbahn baute am Bahnhof zwei Beamtenwohnhäuser, um für die dort tätigen 17 Beamten und Arbeiter Wohnraum zu schaffen. 1905 hatte der Volpriehäuser Bahnhof schon ein tägliches Aufkommen von mehr als 1000 Fahrgästen. Bereits im Jahre 1900 wurde das Hotel „Sollinger Wald“ mit komfortablen Fremdenzimmern eröffnet, da die vorhandenen Gästezimmer in den Gastwirtschaften nicht mehr ausreichten.
Im Jahre 1903 erhielten auf Anordnung der Kreisbehörde die vier wichtigsten Straßen im Dorf Namen und wurden durch Schilder kenntlich gemacht. An den Straßen wurden Straßenlaternen aufgestellt, die von der elektrischen Zentrale des Kaliwerks mit Strom versorgt wurden. 1905 war die erst 1889 gebaute Schule zu klein geworden . Nahe dem Rehbach entstand ein großzügiger Neubau, der noch heute als Grundschule genutzt wird. Nach einer Typhusepidemie im Jahre 1905 erhielt das Dorf eine zentrale Wasserversorgung, die aus dem Quellgebiet der Brunie in Delliehausen gespeist wurde. Das Steueraufkommen der Gemeinde verbesserte sich erheblich und übertraf zeitweise das der Kreisstadt Uslar ( von Stempel / Stein 1931, 86). Die Landwirte , unter deren Land Salz gefördert wurde, erhielten als Entschädigung nach dem hannoverschen Bergrecht Förderzins, der pro Doppelzentner Steinsalz zwei Pfennig und pro Doppelzentner Kalisalz vier Pfennig betrug.
Im Jahre 1904 wurde zur schnelleren Erfassung und Versteuerung des geförderten Steinsalzes sogar ein Preussisches Salzsteueramt eingerichtet.
Eine Zeit der kulturellen Blüte
Von der Jahrhundertwende bis zum Ende der zwanziger Jahre erlebte das Vereinsleben im Dorf eine kaum vorstellbare Blütezeit . Durch den Zuzug hunderter von Menschen aus vielen Teilen Deutschlands erhielt das Dorfleben mannigfache neue Impulse. Vor dem Bau des Kaliwerks gab es im Dorf nur den Männergesangverein „Concordia“ und den Turnverein. Nun wurden zahlreiche neue Vereine gegründet. In ihnen spiegelte sich deutlich erkennbar die veränderte gesellschaftliche Struktur des Dorfes wider. Zwar standen die meisten Vereine allen Einwohnerschichten offen, doch überwogen die Arbeiter – und Geselligkeitsvereine . In ihnen wurden vor allem die bergmännischen Traditionen gepflegt. 1898 wurde der Bergmannsverein „Glückauf“ gegründet, zwei Jahre später die Bergmannskapelle und der Bergmannsverein „Schlegel und Eisen“. Seit 1901 fanden jährlich Bergmannsfeste statt. Sie begannen mit einem Kommers, dem ein Festgottesdienst und ein Festumzug durch das Dorf folgten. Ein Festball und ein vom Kaliwerk gestiftetes Feuerwerk bildeten den Abschluss. Die Bergmannskapelle hatte sich unter ihrem fachlich hervorragenden Dirigenten Herlitz bald auch außerhalb des Dorfes einen Namen gemacht. Berühmte Dirigenten und Solisten aus Italien und Frankreich gaben mit der Kapelle in der Kirche begeistert aufgenommene Konzerte. Auch Ensembles norddeutscher Tournéetheater kamen immer wieder zu Gastspielen nach Volpriehausen.
Neben den bergmännischen Traditionsvereinen spielte der Arbeiter-Radfahrerverein eine wichtige Rolle bei der Erkundung der neuen Heimat. Auch in den Nachbarorten Schlarpe und Hardegsen, in denen viele Bergleute wohnten, wurden Bergmannsvereine gegründet. 1905 gründete Pastor Engel den kirchlichen Posaunenchor, in dem auch mehrere Mitglieder der Bergmannskapelle spielten. In den folgenden Jahren wurden der Kriegerverein, der Schützenverein, der Verkehrsverein und der Junggesellenverein gegründet. Dem Club Eintracht, dem Gustav-Adolf-Verein, einem wohltätigen Verein mit einer Theatergruppe, und dem Stenographenverein gehörten Mitglieder der Mittelschicht und der Oberschicht an. Frauen nahmen am Vereinsleben des Heimatvereins und des Gustav – Adolf – Vereins teil. Sie engagierten sich aber vor allem in der Wohlfahrtspflege und gründeten einen Zweigverein des Vaterländischen Frauenvereins vom Roten Kreuz (Herbst 1992, 33 ff.).
Das Ende des Salzbergbaus
Anfang der zwanziger Jahre führten die zunehmende Überproduktion von Kalisalzen sowie Mechanisierungsmaßnahmen und ein starker Rückgang des Exports zu Entlassungen und zu Werksschließungen. Von den ursprünglich 217 Kalibergwerken waren im Jahre 1927 nur noch 61 mit insgesamt 22 107 Arbeitsplätzen übriggeblieben, darunter auch „Wittekind – Hildasglück“ (Albrecht 1928, 106). Dies war vor allem dem Generaldirektor der Burbach AG Helmut Albrecht zu verdanken, der in Volpriehausen wohnte. Er hatte sich allen Versuchen, das Werk „Wittekind-Hildasglück“ wegen der nur noch schwer abbaubaren Salzlager stillzulegen, widersetzt. Nach Aussagen Direktor Westermanns überschritten die Selbstkosten häufig die späteren Erlöse. Um „Wittekind“ zu erhalten, mussten weit bessere Werke ihre Produktion einstellen ( NHStA Hann 310 ).
Anfang der dreissiger Jahre verschlechterte sich die Absatzlage im deutschen Stein-und Kalisalzbergbau dramatisch. Auch in Volpriehausen wurden viele Bergleute arbeitslos. In den Jahren 1932 und 1933 befand sich nur noch eine Stammmannschaft von etwa 220 Bergleuten im Werk, die im Sommer bis zu acht Wochen Feierschichten einlegen musste (AKBM, Burbach Schriftwechsel). Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten musste das Werk aus politischen Gründen wieder zahlreiche Neueinstellungen vornehmen. Im Jahre 1937 arbeiteten 600 Arbeiter und Angestellte in beiden Werken, eine seit vielen Jahren nicht mehr erreichte Mitarbeiterzahl. Die wirtschaftliche Lage des Werkes verbesserte sich allerdings nicht. Generaldirektor Albrecht bot schließlich 1937 in einem Schreiben an das Oberbergamt in Clausthal an, dem Oberkommando der Wehrmacht das Werk „Wittekind-Hildasglück“ zur Verfügung zu stellen, um so wenigstens 120 Arbeitsplätze zu erhalten (AKBM , Burbach Schriftwechsel).
Die beschleunigte Aufrüstung des Heeres und der anderen Waffengattungen schon bald nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten kam seinen Absichten dabei sehr entgegen. Nach erfolgreichen Munitionslagerversuchen waren nämlich bereits 1934 mehrere stillgelegte Salzbergwerke vom Oberkommando der Wehrmacht zur Herrichtung für die Munitionslagerung übernommen worden. Infolge der enormen Waffen – und Munitionsproduktion reichten 1937 die vorhandenen Lagerkapazitäten nicht mehr aus. Das Oberkommando der Wehrmacht trat deshalb in Verhandlungen mit der „Burbach Bergbau AG“ ein mit dem Ziel, das Werk „Wittekind – Hildasglück“ und andere stillgelegte Salzbergwerke für die Munitionslagerung zu übernehmen. Nach Abschluss der Verhandlungen wurden vom 1. Juli 1937 an bis zum 31. 12. 1953 die Über – und Untertageanlagen des Kalisalzbergwerks „Wittekind – Hildasglück“ an die Wehrmacht verpachtet.
Die Heeresmunitionsanstalt
Unmittelbar nach der Übernahme der Werksanlagen begannen umfangreiche Abbruch – und Neubauarbeiten im Übertagebereich. Entlang der heutigen B 241 wurden in Werksnähe Gemeinschaftshäuser für die Belegschaft und am Osttor mehrere Baracken als provisorische Unterkünfte gebaut. 1939 wurde eine Stichstraße zum geplanten Fertigungsgebiet in einem nahegelegenen Waldstück unterhalb des Schachts „Hildasglück“ angelegt.
Im Untertagebereich wurden auf den 540 m und 917 m – Sohlen von bergmännischem Fachpersonal Munitionslagerkammern in das standfeste Steinsalz gesprengt. Sie hatten eine Größe von 18 x 22,5 m bzw. 10 x 18 m und eine Höhe von 2,5 m und konnten 100 oder 50 t Munition aufnehmen. Die Munitionsanstalt Volpriehausen war ursprünglich für eine Lagerkapazität von 13 000 t Munition vorgesehen, wurde aber bis zum Kriegsende auf eine Kapazität von etwa 30 000 t ausgebaut. Sie war damit die größte Heeresmunitionsanstalt des Deutschen Reichs in einem Bergwerk.
Ihre Leitung bestand ausschließlich aus miltärischem Fachpersonal des Munitions – und Gerätewesens. In der Verwaltung waren auch mehrere weibliche und männliche Zivilangestellte tätig. Zur Bewachung des Geländes wurden 60 Angehörige des Landesschutzes aus Göttingen eingesetzt, für die bergmännischen Arbeiten unter Tage 60 bis 100 Bergleute. Die Gesamtzahl der Belegschaft lag zwischen 930 und 1230 Frauen und Männern (Herbst 1983, 51).
Den zahlenmäßig größten Anteil bildeten die arbeits – und kriegshilfsdienstverpflichteten Frauen. Unter ihnen befanden sich Schauspielerinnen
Sängerinnen und Tänzerinnen der Theater in Göttingen und Hannover sowie die Ehefrauen des Northeimer Landrats und des Leiters der Munitionsanstalt. Zur Belegschaft gehörten auch noch zahlreiche weibliche Deportierte aus Polen und der Sowjetunion. Für die Transportarbeiten und das Stapeln der Munitionskisten wurden männliche Deportierte und Kriegsgefangene aus Polen , der Sowjetunion , Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Italien eingesetzt. Hinzu kamen noch zwischen 60 und 200 männliche Häftlinge des sog. Jugendschutzlagers Moringen ( eines Konzentrationslagers für männliche Jugendliche ) , die täglich auf Lastwagen nach Volpriehausen transportiert wurden. Im Juli 1944 wurde in einer Lagerhalle der Munitionsanstalt bis zum 4. April 1945 ein Außenkommando des sog. Jugendschutzlagers eingerichtet, so dass die Jugendlichen dort schlafen konnten.
Die einzelnen Munitionsanstalten waren auf die Fertigung bestimmter Kaliber spezialisiert. In Volpriehausen wurden Kartuschen und Granaten des Kalibers 7,5 und ab 1942 21 cm Wurfgranaten gefertigt und gelagert. Die Teile und das Pulver wurden mit der Bahn angeliefert und unter Tage bis zur Fertigung gelagert. Die Munition wurde in Munitionszügen , die gewöhnlich aus 30 Waggons zu je 15 t Munition bestanden, zu den Bestimmungsorten transportiert (Herbst 1983, 49 ff).
Seit Juni 1944 wurden auf der 660 m – Sohle wertvolle Kulturgüter eingelagert, um sie vor der Zerstörung durch alliierte Bombenangriffe zu bewahren. Es handelte sich dabei überwiegend um Archivbestände aus Northeim, Uslar, Wesel und polnischen Schlössern, 360 000 Bücher und Zeitschriftenbände und Sammlungen der Universität Göttingen und den 1200 wertvollsten Stücken der Bernsteinsammlung der Universität Königsberg. Für die immer wieder in den Medien geäußerte Vermutung, dass auch das Bernsteinzimmer im ehemaligen Kalibergwerk eingelagert wurde, gibt es bis heute keine Bestätigung. (4)
Anfang April 1945 entließ der Leiter der Munitionsanstalt die älteren Offiziere und den größten Teil des Stammpersonals nach Hause. Aus kampffähigen Soldaten wurde eine Einsatztruppe gebildet, die im Schutze des naheliegenden Waldes den Einmarsch der Amerikaner abwarten sollte.
In der Nacht vom 29. zum 30. September explodierten über 20 000 t noch unter Tage eingelagerter Munition infolge des Austritts von Methangas, das vermutlich von Plünderern unbemerkt entzündet wurde. Dabei wurden fünf polnische Deportierte in ihrer Baracke und zwei Feuerwehrmänner getötet und weite Teile der Untertageanlagen zerstört. Der größte Teil der eingelagerten Kulturgüter verbrannte, nur ein kleiner Teil konnte unter schwierigsten Bedingungen in der Zeit zwischen April und Oktober 1946 geborgen werden, bevor die Schachtanlage absoff.
Im Dorf trifft man heute noch auf Schritt und Tritt auf die Spuren des Salzbergbaus: Verschiedene Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Kaliwerks „Wittekind“, die die Explosionskatastrophe überstanden, Direktorenvillen , mehrere Angestellten und Bergarbeiterwohnhäuser , eine Seilscheibe, Teufkübel und nicht zuletzt das Kali – Bergbaumuseum , in dem die Geschichte des Salzbergbaus im südlichen Niedersachsen dokumentiert ist (5). Am Eingang zum Friedhof in Volpriehausen erinnert ein Gedenkstein an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Anmerkungen
- Siehe den Beitrag von G. Stromeier in diesem Band.
- Abbauberechtigung für ein begrenztes Gebiet
- Bergbauliche Unternehmensform einer Kapitalgesellschaft
- Das Bernsteinzimmer war ein Geschenk des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I an den russischen Zaren Peter I. Im Oktober 1941 wurde es auf Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht aus dem Katharinenpalais in Zarskoje Selo nach Königsberg gebracht und im dortigen Schloss bis zum Sommer 1944 ausgestellt. Seitdem gilt es als verschollen.
- Das Museum ist für Einzelbesucher von April bis Oktober samstags von 15 bis 17 Uhr, für Gruppen nach vorheriger Terminabsprache unter einer der Telefon-Nummern (0 55 73) 5 55, 12 57 und 14 14 ganzjährig geöffnet.
Ungedruckte Quellen
Nds. Hauptstaatsarchiv Hannover (Nds.HstA H)
Hann 310
Archiv des Kalibergbau Museums Volpriehausen (AKBM)
Burbach Briefwechsel
Gedruckte Quellen und Literatur
Helmut Albrecht, Der Kalibergbau, in: W.Hölling und Dr.A. Pinkerneil, Die deutsche Bergwirtschaft der Gegenwart, Berlin 1928, S. 105-110
F. Beyschlag, Allgemeine geologische Einführung , in: Deutschlands Kalibergbau, Berlin 1907, Teil I / S. 1-23
Jean –Francois Bergier, Die Geschichte vom Salz, Zürich 1989
Peter Bosse, Salz und Salzmineralien, in: Emser 1 / 90, S. 10-17
Burbach Bergbau AG (Hg.), Geschichte des Burbach – Konzerns, Magdeburg 1928
Deutscher Bergarbeiterverband, Flugblatt : An alle Bergarbeiter , Hannover 1906
Günther Duchrow, Sondershausen in der deutschen Kaligeschichte, Sondershausen 2000
Hans-Heinz Emons und Hans-Henning Walter, Alte Salinen in Mitteleuropa, Leipzig 1988
H. Everding, Zur Geologie der Deutschen Zechsteinsalze, in: Deutschlands Kalibergbau, Berlin 1907 , Teil I / S. 25-131
Gemeindelexikon für die Provinz Hannover, Berlin 1908
Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, IX Provinz Hannover, Berlin 1897
Geologische Karte von Niedersachsen, Erläuterungen zu Blatt Hardegsen, Nr . 4324,
Hannover 1968
Karl-Hermann Hauske und Dietrich Fulda, Kali, das bunte , bittere Salz, Leipzig 1990
Detlev Herbst, 750 Jahre Volpriehausen, Göttingen 1983
Detlev Herbst, Sie kämpften um höhere Löhne, in: Sollinger Heimatblätter 3/86, S. 16-20
Detlev Herbst, Festschrift 750 Jahre Volpriehausen, Die örtlichen Vereine, Volpriehausen 1992, S. 33-88
Detlev Herbst, Die Heeresmunitionsanstalt Volpriehausen, in: Arbeitsgemeinschaft Südniedersächsischer Heimatfreunde (Hg.): Rüstungsindustrie in Südniedersachsen während der NS – Zeit, Mannheim 1993, S. 38-118
Dietrich Hoffmann, Elf Jahrzehnte deutscher Kalisalzbergbau, Essen 1972
Fachzeitung „Industrie“ ( Sonderdruck ), Deutsche Kali-Industrie, Berlin 1906
Dr. A. Jacob u. A. Kabitzsch, Die Gewinnung der Kalisalze, Berlin 1929
Dr. Walter Junge, Chronik des Fleckens Bodenfelde, Bodenfelde 1983
Kali – Handbuch für das Jahr 1922, Magdeburg 1922
Kaliverein e. V., Die Kaliindustrie in der Bundesrepublik Deutschland, Essen 1967
L. Loewe, Die bergmännische Gewinnung der Kalisalze, in: Deutschlands Kalibergbau, Berlin 1907, Teil II / S. 1-145
W. Michels und C. Przibylla, Die Kalirohsalze und ihre Verarbeitung, Leipzig 1916
H. Paxmann, Wirtschaftliche , rechtliche und statistische Verhältnisse der Kaliindustrie, in Deutschlands Kalibergbau , Berlin 1907, Teil III / S.1-230 S. 152
L. Scholl, Der Kalibergbau, in : Dr. Freiherr von Stempel und E. Stein (Hg.) Monographien deutscher Landkreise, Der Kreis Uslar, Berlin 1931, S. 60-63
Sollinger Nachrichten, Uslar 1901 – 1942
Rainer Slotta, Technische Denkmäler in der Bundesrepublik Deutschland, Band 3, Die Kali- und Steinsalzindustrie, Bochum 1980
Freiherr von Stempel und Erwin Stein (Hg.) Monographien deutscher Landkreise, Der Kreis Uslar, Band VI, Berlin 1931
Abbildungsnachweis
Abb. 1-10, Kali- Bergbaumuseum Volpriehausen
Angaben zur Person des Autors
Lehrer, Ortsheimatpfleger und Leiter des Kali-Bergbaumuseums Volpriehausen
Abbildungen
- Blick vom Wasserturm auf das Werk „Wittekind“ (1937)
2) Elektrische Zentrale des Werks „Wittekind“ (1925)
- Bergleute, die den Schacht „Hildasglück“ abteuften (Teufdrittel) (1908)
4) Das Werk „Hildasglück“ (1928)
5) Pumpenanlage der Sulfatfabrik , Werk „Justus I“ , (1905)
- Lösebecken in der Siedesalzanlage, Werk „Wittekind“ (1937)
- Bergleute mit einem Grubenpferd auf der 540 m –Sohle (1905)
- Hauer beim Bohren der Sprenglöcher mit einer Säulendrehbohrmaschine ( 1938)
- Festzug anläßlich des Bergmannsfestes auf der Bollertstraße (1934)
10) Osttor der Heeresmunitionsanstalt mit Fördergerüst (1944)